William Borm
| Geburtstag: |
|
| Todestag: |
|
| Nation: |
|
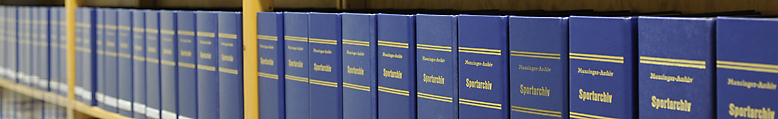
| Geburtstag: |
|
| Todestag: |
|
| Nation: |
|
Internationales Biographisches Archiv
William Borm war Sohn eines Möbelkaufmanns in Hamburg-Elmsbüttel. Infolge geschäftlicher Abwesenheit des Vaters in Indien besuchte er bis zum Abitur 1914 ein Gymnasium in Bautzen in Sachsen und wurde hier im Haus seines Onkels großbürgerlich-nationalliberal erzogen. In diesem Haus verkehrten auch Walter Rathenau und Gustav Stresemann. Den Ersten Weltkrieg machte er von 1915 bis 1918 als Freiwilliger in einem Husarenregiment mit und wurde als Reserve-Offizier mehrfach ausgezeichnet.
Ab 1919 studierte er bis 1924 Volkswirtschaft (ohne akad. Abschluß) an der Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin. 1923 trat er in das väterliche Geschäft ein, das inzwischen nach Berlin verlegt worden war. Bis 1929 arbeitete er als Handelsvertreter, dann gründete er eine eigene Firma (Elektroakustik). Im Zweiten Weltkrieg war der "Wehrwirtschaftsführer" als Leiter eines kriegswichtigen Betriebes "unabkömmlich". Daß er nicht aktiv Widerstand gegen das NS-Regime leistete, hat er als entscheidendes Versäumnis seines Lebens gewertet. Das Kriegsende 1945 brachte die Zerstörung der Firma und mühevollen Wiederaufbau. Während der war er Vorsitzender des Industrie-Ausschusses im US-Sektor von Berlin und stellv. Vorsitzender des Industrie-Ausschusses West. Von 1946-5-leitete er als Vorsitzender den Verband der Berliner Elektroindustrie.
Politisch gehörte B. von 1924-33, bis zu deren Auflösung, der Deutschen Volkspartei an. 1945 trat er unmittelbar nach ihrer Gründung der damaligen Liberaldemokratischen Partei (LDP) bei und leitete deren Industrie-Ausschuß. Ab 1947 wirkte B. als Schatzmeister des Berliner Landesverbandes der F.D.P. (zuvor LDP), von 1948-50 als stellv. Vorsitzender des Landesverbandes Berlin. Am 23. Sept. 1950 verhaftete ihn die Volkspolizei der DDR auf der Autobahn am amtlichen Übergang Wartha, als er sich auf einer Fahrt zu einer Sitzung in Kassel befand. Nach fast zweijähriger Haft bei den Staatssicherheitsbehörden der DDR wurde er 1952 nach Kontrollratsdirektive 36 III A 3 (angebliche Kriegs- und Boykotthetze) zur Höchststrafe von 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Er wurde in den Strafanstalten Bützow-Dreibergen, Luckau und Cottbus festgehalten und erst am 28. Aug. 1959 entlassen.
1960-69 war "Sir William ", wie ihn seine Freunde nannten, 1. Vorsitzender des Landesverbandes Berlin der F.D.P. (danach Ehrenvorsitzender), 1963-67 Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, 1965-72 Berliner Vertreter im Deutschen Bundestag und Alterspräsident. 1972 wurde er von dem mehr linksliberal beherrschten Landesausschuß erneut als Berliner FDP-Vertreter nominiert, doch entsandte die Fraktion dann Hans Günter Hoppe nach Bonn. Im Nov. 1963 legte B. anläßlich einer Tagung des Kuratoriums Unteilbares Deutschland einen Deutschlandplan vor, der aber mehr Kritik als Zustimmung auslöste.
In den Jahren des beginnenden West-Ost-Dialogs war B. ein beredter Fürsprecher der Passierscheinverhandlungen des Berliner Senats und Verfechter des von der F.D.P. vorgeschlagenen Generalvertrags mit der DDR. Die Autorität B.s wuchs in seiner Partei mit zunehmendem Alter. 1975 vermochte er auf dem Landesparteitag der F.D.P. durch einen leidenschaftlichen Appell an die Zerstrittenen den Berliner Landesverband vor größerem Schaden zu bewahren.
B. gehörte seit 1970 auch dem FDP-Bundesvorstand an und war Mitglied, zeitweilig auch Vorsitzender des Bundesfachausschusses der Partei für Außen-, Deutschland- und Sicherheitspolitik seiner Partei. Im Herbst 1978 setzte sich B. in einem Manifest mit dem Titel "Erneuerung des liberalen Anspruchs der F.D.P." für liberalen Fortschritt und die Wiederbelebung der Freiburger Thesen von 1971 ein. Beim FDP-Parteitag in Mainz richtete sich B.s Kritik gegen den Zustand der liberalen Partei und vor allem gegen den Genscher-Kurs. In der Deutschlandpolitik plädierte B. 1979 für ein Nachgeben in der Frage zweier deutscher Staatsangehörigkeiten. Trotz fortschreitenden Alters verlor er nicht an geistiger Frische und Entschlossenheit, auch unbequeme Ansichten ohne taktisches Kalkül und Rücksicht auf Parteiräson zu vertreten. Das zeigte sich z.B. in seinem Engagement für die Friedensbewegung und gegen das atomare Wettrüsten der Supermächte, als er die "Berliner Initiative für Frieden, internationalen Ausgleich und Sicherheit" (81) mittrug und eine Abkehr vom NATO-Nachrüstungsdoppelbeschluß forderte. Auch auf der großen Bonner Friedenskundgebung vom 10. Okt. 1981 trat B. gegen den Willen des Parteivorstands als Redner auf. Der Bruch der sozialliberalen Koalition am 17. Sept. 1982 bewegte B. auch zum Abschied von dieser F.D.P. B. ist von 1971-72 Mitglied des europäischen Parlaments gewesen.
Auszeichnungen: Großes Bundesverdienstkreuz (70), Ernst Reuter Plakette (75) und Ossietzky-Medaille (82). Am 25. Sept. 1985 verlieh ihm die rechtswissenschaftliche Fakultät der Karl-Marx-Universität in Leipzig die Würde eines Ehrendoktors. B. sah in dieser Auszeichnung eine "ausgestreckte Hand der DDR", die es nach den Erfahrungen seiner Haft zu ergreifen galt.
Mit seiner Frau Lulu, geb. Kleinwort, hatte er einen Sohn Henning Jürgen. Im Alter von 92 Jahren starb B. Anfang Sept. 1987 in Bonn.
letzte Reiherbeize 6, 1000 Berlin 37, Tel.: 030/813 74 06
